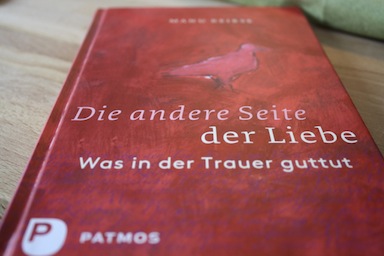Wenn ein Roman „Die Kunst des Feldspiels“ heißt und im Klappentext schon etwas von Baseball steht, muss man sich nicht davon abschrecken lassen, auch wenn man keine Ahnung von Baseball hat. Man hat doch von vielen Dingen keine Ahnung, über die man liest, und auch wenn Baseball tatsächlich eine nicht unwichtige Rolle in Chad Harbachs Debütroman spielt, stört das nicht. Mich hat es jedenfalls nicht gestört (bis auf eine Baseball-Ballung am Schluss). Fußball wäre für mich nicht besser gewesen, das ist zwar vertrauter, aber es interessiert mich gar nicht. Noch weniger ansprechend hätte ich Tennis gefunden, und Golf erst … Sportarten stehen nicht im luftleeren Raum, man hat Bilder davon im Kopf, ein bestimmtes Milieu vor Augen, die Menschen, die diesen Sport betreiben und die Menschen, die sich diesen Sport live oder im Fernsehen anschauen.
Baseball ist fremd, Baseball ist Amerika, Baseball ist – das große Unbekannte, so wie jedes Buch, wenn man es anfängt zu lesen. Wenn man mit „Die Kunst des Feldspiels“ fertig ist, wird Baseball nicht unbedingt ein guter Bekannter sein, aber ein Unbekannter auch nicht mehr. Endlich wieder ein Buch, in dem sich nicht alles um eine Person oder um ein Liebespaar dreht, sondern in dem ein fesselndes Beziehungsnetz geflochten wird, fünf Personen im Zentrum, in der Peripherie noch einige mehr, die auch nicht nur Wasserträger der Handlung sind. Man denkt an John Irving (der auf dem Buchcover zitiert wird, lobend äußert er sich über Chad Harbachs Roman), diese Art von Figurennetz baut er ebenfalls, seine Geschichten und Leute sind vielleicht noch etwas skurriler als die in „Die Kunst des Feldspiels“, diese sind ziemlich normal, geerdet, die Leute von nebenan quasi (wenn auch mit einer Prise Wunderbarkeit, die sie unverwechselbar macht), und sie sind so wahrhaftig dargestellt und reden ebenso, dass man sich an Stephen Kings Romane erinnert fühlt. Und es gibt diese Stellen, die man sich rausschreiben will, rausschreiben würde, müsste man nicht ohne Pause weiterlesen. Ein richtig gutes Buch, eines, das man, trotzdem es 600 Seiten stark ist (die Schrift ist eher klein), gar nicht mehr aus der Hand legen kann.