Manon García hat ein Buch über Hochbegabung geschrieben: „Sind Sie noch Katze oder schon Hund? Hochbegabung nach dem Testergebnis“. Es gebe zwar Bücher über und für hochbegabte Kinder (und deren Eltern), für Erwachsene habe sie bei der Recherche jedoch lediglich ein-zwei Bücher gefunden, die aber nichts Umfassendes zum Thema lieferten. Die Autorin legt nun ein Buch vor, das nicht ganz Ratgeber und nicht ganz Sachbuch ist. Stark ist das Buch, wenn García von ihrem eigenen Erleben erzählt. Mit 38 hatte sie einen IQ-Test gemacht und erfahren, dass sie hochbegabt ist. Ihre Reaktion auf das Testergebnis schildert sie im 1. Kapitel anhand von sechs Phasen nach Heinz-Detlef Scheer: Überraschung, Euphorie, Ernüchterung, Aggression, Trauer und Versöhnung.
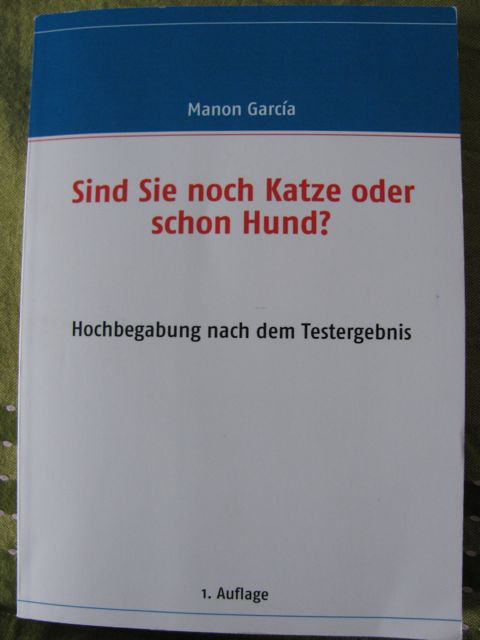
Das Persönliche zieht sich durch das ganze Buch, und auch der Leser oder die Leserin werden direkt angesprochen, gesiezt, um genau zu sein. Denn das Buch wendet sich an Hochbegabte, mit denen García ihre Erfahrungen teilen und denen sie auch Hilfen für die Zeit nach dem Test geben möchte. Dass die Autorin ihren eigenen Weg schildert, passt gut – ich kann mir vorstellen, dass die Identifikationsmöglichkeit für andere spät erkannte Hochbegabte recht groß ist. Sicher lässt sich das Leben nach dem Test auch nicht verallgemeinern, sodass Handlungsanweisungen oder ähnliches fehl am Platz wären.
Wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln, ist das Buch teils etwas schwerfällig, zitiert zu umfangreich. Es werden die Autorennamen genannt, der Titel jedoch zumeist nicht. Dafür muss man zurückblättern, in den Anhang. Zum Beispiel war von dem Auszeit-Buch Hape Kerkelings die Rede, jedoch wurde nicht erwähnt, wie es heißt. (Blättern.) Oder von einem Film Jodie Fosters, in dem es um ein hochbegabtes Kind geht, aber wie hieß er gleich noch mal? (Blättern.) Das sind jedoch Kleinigkeiten, die ein geringes Gewicht haben im Vergleich zu dem Gewinn, lesenswerte Informationen gut aufbereitet präsentiert zu bekommen. Als sehr interessant habe ich zum Beispiel die Abschnitte zur pränatalen Entwicklung und zum Schulsystem empfunden sowie über die Berichterstattung zum Thema Hochbegabung in den Medien.
In der BRD war (intellektuelle) Hochbegabung zunächst kein Thema, von den 50ern bis in die 80er Jahre hinein gab es nur die Pole „Wunderkind“ und „Schulversager“ – Extreme und Anderssein waren unerwünscht, (intellektuelle) Hochbegabte wurden nicht gefördert. Besser wurde das nach 1985, in jenem Jahr war in Hamburg die „6. Weltkonferenz für hochbegabte und talentierte Kinder“. Hier findet sich schon eine Erklärung, warum aktuell spät erkannte Hochbegabung ein Thema ist: Die Kinder aus der Zeit, in der Hochbegabung als gesellschaftlich nicht relevant betrachtet wurde, sind längst erwachsen und setzen sich nun mit ihrem „Anderssein“, wie es die Autorin auch nennt, auseinander. In der DDR wurde mit Hochbegabung anders umgegangen, dazu erfährt man aber nichts Näheres.
Das „Anderssein“ und die Probleme von spät erkannten Hochbegabten lassen sich Menschen, die selbst nicht unmittelbar betroffen sind, schlecht vermitteln. So fand Manon García das Bild eines Hundes, der unter Katzen aufwächst und erst spät merkt, dass er „anders“ ist. Mit diesem Verlgeich gelingt der Autorin die Veranschaulichung tatsächlich sehr gut. Hund und Katze sind verschieden, das beginnt schon beim Schwanzwedeln, das eine unterschiedliche Bedeutung hat (Hund: Freude und Spiel, Katze: Gefahr und Angriff). Meist wird ja die Katze, die unabhängig ist und ihren Halter gut dressiert (siehe Simon’s Cat ;-)), als schlauer als der Hund angesehen, der auch beim 20. Mal noch dem Stöckchen nachrennt. Aber warum soll man nicht mal die Perspektive wechseln? Der Hund ist lernwilliger als die Katze, er hat Potenziale, die sich im Training mit seiner Halterin oder seinem Halter ausschöpfen lassen. Eine Katze lebt ihr Leben, man wird ihr noch beibringen können, aufs Katzenklo zu gehen, aber sonst? (Falls das jetzt nicht stimmt, könnt Ihr Euch gern in den Kommentaren austoben. Das ist meine bescheidene Meinung als Nicht-Katzen- und Nicht-Hundebesitzerin.) Dumm ist die Katze natürlich trotzdem nicht, aber der Hund ebenso nicht. (Und ein bisschen Provokation muss sein.)
Manon Garcías Beispielhund ist „anders“ als seine Katzenfamilie, und er muss erst lernen, damit umzugehen. Genau so heißt hochbegabt eben nicht, dass man automatisch höher, schneller, weiter denkt und leistet als Nicht-Hochbegabte, sondern: Auch Hochbegabte müssen gefördert werden und lernen, um zum einen Höchstleistungen bringen und zum anderen sich in der eigenen Haut wohlfühlen zu können. García zeigt, dass Hochbegabte, die sich an „Normalbegabte“ anpassen und ihr eigenes Potenzial nicht verfolgen, oft mit sich selbst und ihrem Leben unzufrieden sind. Ein Test auf Hochbegabung zeigt also einerseits in die Zukunft – man hat die Möglichkeit, etwas zu verändern. Andererseits ist angeraten, zuvor in die eigene Vergangenheit zu schauen, um mit dem neuen Bewusstsein der Hochbegabung zu verstehen, warum man z. B. in der Schule und der Familie eher ein Außenseiter, der Klassenclown oder der „Versager“ war.
Im 5. Kapitel, „Rückschlüsse“, werden für spät erkannte Hochbegabte einige Wege aufgezeigt, wie sie ihr Leben ändern können, so sie das wollen. García nennt Selbstcoaching (eine interessante Technik für jeden, nicht nur für Hochbegabte), eine Auszeit nehmen (Hape Kerkelings Buch, das hier zitiert wird, heißt „Ich bin dann mal weg“), ein Erfolgsteam bzw. einen Mentor suchen. Für spät erkannte Hochbegabte gebe es keine Förderungsprogramme, man muss sich also alles selbst zusammenbasteln. Dazu biete das Web 2.0 zahlreiche Möglichkeiten, so die Autorin.
Fazit: Ein sehr informatives Buch, das sich natürlich auch damit auseinandersetzt, wann man von Hochbegabung spricht, welche Arten es gibt, was die Gehirnforschung zu dem Thema zu sagen hat usw. Das Bild von dem Hund, der keine Katze ist, das aber erst spät mitbekommt, finde ich gut, nur wird es ein wenig zu sehr ausgereizt, der Vergleich hätte nicht in jedem Unterkapitel bemüht werden müssen. Ich denke, das Buch kann eine große Hilfe für spät erkannte Hochbegabte sein. Es wurde in Eigenregie bei BoD veröffentlicht, da Verlage, die die Autorin kontaktierte, die Zielgruppe als „zu klein“ ansahen. Was zu beweisen wäre …
Zum Schluss noch ein Schmankerl aus dem Buch: Auf der Website des Mensa e.V. gibt es einen Online-Kurztest, in dessen Auswertung man erfährt, ob ein „richtiger“ IQ-Test sinnvoll wäre. ;-)
Manon García: Sind Sie noch Katze oder schon Hund?
Hochbegabung nach dem Testergebnis
BoD
200 Seiten
19,95 Euro
ISBN 978–3‑8391–9967‑1
