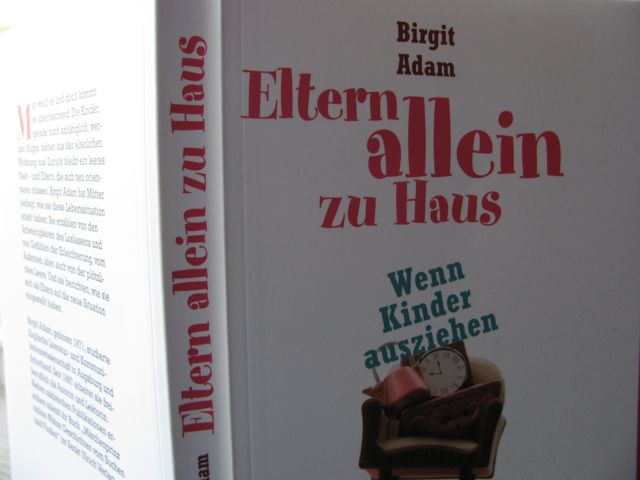Da liegt mal wieder ein äußerst hübsches Buch auf dem Schreibtisch, das Cover zeigt einen Fuß im Ballerina-Schuh und ein Stück Kleid, rot mit weißen Punkten, und klar, das muss was Spanisches sein! Der „Fettnäpfchenführer Spanien“ von Lisa Graf-Riemann will (laut Untertiel) verraten, „wie man den Stier bei den Hörnern packt“. Das weiß ich nach dem Lesen zwar immer noch nicht, ich gehe ja noch nicht mal freiwillig über eine Weide mit Kühen ohne Hörner, selbst wenn das eine Abkürzung wäre, aber …
Ja, ich bin jetzt schlauer als vorher, was Spanien betrifft, und wäre gern bereit, den Stier im übertragenen Sinne bei den Hörnern zu packen, es also vor Ort, zum Beispiel in Madrid oder doch mal wieder in Gijón, drauf ankommen zu lassen. Schade, dass der Urlaub in diesem Jahr anderswohin geht. Der Stierkampf ist ja ein Fettnäpfchenthema, das war mir schon bekannt, aber welche Fülle von Fettnäpfchen Deutsche in Spanien erwartet, fand ich doch allerhand.
Der „Fettnäpfchenführer“ ist kein Reiseführer, sondern ein „Land- und Leuteführer“, der enorm kurzweilig richtig viele Informationen rüberbringt. Der Leser begleitet Tom und Lena aus Deutschland, die frisch nach Spanien gekommen sind: Der eine tritt einen neuen Job in einer Softwarefirma in Madrid an, die andere wird einen Sprachkurs in Alicante besuchen. Wie es den beiden Deutschen mit WG-Mitbewohnerinnen, Arbeitskollegen, bei Ausflügen, beim Telefonieren, bei Festen usw. ergeht, wird in 33 knackigen Kapiteln berichtet, die jeweils in drei Teile untergliedert sind.
Erst kommt immer die Situation:
Zum Beispiel geht Tom mit Geschäftspartnern essen und will dabei eigentlich über die Arbeit reden. Damit blitzt er allerdings ab. Sein Sitznachbar fragt ihn, wie er mit der Mentalität der Spanier zurechtkomme, worauf Tom erzählt, dass er einiges nicht verstehe, die Sache mit dem Stierkampf zum Beispiel und die mit der ETA. Damit bringt er das Tischgespräch zum Erliegen.
Dann wird gefragt: „Was ist da schiefgelaufen?“
Die Antwort wäre hier: Bei Businessessen wird nicht übers Geschäft geredet, politische und kontroverse Themen sind zu meiden.
Zuletzt gibt es Tipps: „Was können Sie besser machen?“
In diesem Fall: nett und freundlich sein, sich von der Schokoladenseite zeigen, keine Themen wählen, mit denen man aneckt.
Im eigentlichen Text sind zwar schon etliche Informationen untergebracht, doch weiterführende, ausführlichere Erläuterungen wurden leserfreundlich in graue Kästchen gepackt. Wenn man will, kann man sich also gleich über spanische Käsesorten, „Sorteo de Navidad“ (spanische Weihnachtslotterie), Pedro Almodóvar, „Hoy pago yo“ (Heute zahle ich.) usw. schlau machen – oder das beliebig nachholen.
Sehr schön ist auch, dass spanische Wörter und Wendungen hin und wieder ganz locker und lässig in den Text eingebaut und wiederholt verwendet werden, sodass man am Ende quasi im Vorbeigehen schon etwas mitgenommen hat. Hier zeigt sich die Expertin, die die Autorin ist, da sie viele Jahr Spanisch unterrichtet und Spanisch-Lehrbücher verfasst hat. Dass in Spanien eben nicht nur Spanisch gesprochen wird, und dass Katalanisch und Baskisch keine Dialekte, sondern eigene Sprachen sind, nun, das ist auf jeden Fall gut zu wissen! Die Sache mit der „Hispanisierung“ ausländischer Worte fand ich lustig, besonders dieses Beispiel: „Mecklenburgo Antepomerania“. Gefällt mir eigentlich besser als das Original. ;)
Ich habe dieses Buch in einem Rutsch gelesen und bin jetzt, wie gesagt, um einiges schlauer als vorher. Der „Fettnäpfchenführer Spanien“ ist genau richtig für Urlauber, die nicht nur im Hotel sitzen, Studenten, die ihr Erasmus-Jahr in Spanien verbringen wollen und überhaupt alle, die sich für das Land und die Leute interessieren. Dass man dann alle Fettnäpfchen vermeidet und sofort ‚hispanisiert‘ ist, glaube ich ja nun nicht. Aber man hat auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Päckchen geschnürt – nicht zu vergessen die große Portion Neugier darauf, das alles ‚in echt‘ auszuprobieren …
Ach, Spanien, wie schade, dass es dieses Jahr nichts wird … Aber bald!
Lisa Graf-Riemann
Fettnäpfchenführer Spanien
Conbook Verlag
288 Seiten
10,95 Euro
ISBN 978–3‑934918–75‑7