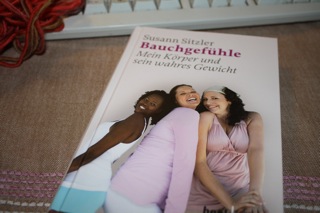Fangen wir mit dem Titel an. „Der Autor und der Lektor“, wie irritierend. Klingt eher nach einem Roman als nach einer Anthologie, schließlich gibt es Autoren und Autorinnen, Lektorinnen und Lektoren. Lektorinnen wahrscheinlich mehr als Lektoren, aber das ist jetzt keine Aussage, auf die ich mich festnageln lassen würde. Das Buch ist 2010 im Wallstein Verlag erschienen. 2011 muss ein gutes Jahr für diesen Verlag sein, denn zum einen feiert er das 25. Jahr seines Bestehens und zum andern wurde die Wallstein-Autorin Maja Haderlap für ihren Roman „Engel des Vergessens“ in Klagenfurt mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet, was den Verkaufszahlen mit Sicherheit nicht abträglich ist.
Ich habe dieses Buch schon eine ganze Weile bei mir herumliegen, und zwar nicht, weil ich keine Zeit zum Lesen gehabt hätte. Es war erst etwas sperrig, dieses weiße Büchlein mit seinen 207 Seiten, das sich eigentlich ziemlich schnell lesen ließe, wenn es nicht so – viel wäre. Ja, viel, ein besseres Wort fällt mir dafür nicht ein. Die Texte von vierunddreißig Autoren und elf Autorinnen sind in diesem Buch versammelt, in Prosa oder Lyrik haben sie über ihre Arbeit oder ihr Verhältnis zu ihrem Lektor geschrieben.
Was mir fehlte, war eine Übersicht am Ende des Buches, in der alle Autorinnen und Autoren kurz vorgestellt werden, mit einigen biographischen Daten und ihren Werken. Ja, ein Martin Walser ist bekannt, eine Friederike Mayröcker auch, aber bei etlichen wusste zumindest ich nicht, um wen es geht. Muss ich also recherchieren, wider die Bequemlichkeit!
Ich hatte angefangen zu lesen. Irgendwann merkte ich, dass ich den Fuß nicht in das Buch bekomme (sozusagen) und dass mir ein Steinchen im Mosaik fehlt. Zum Glück fand ich es noch. Das Steinchen hat sogar einen Namen. Es heißt Thorsten Ahrend und ist 2010 fünfzig Jahre alt geworden. Ahrend ist Lektor beim Wallstein Verlag und sein Verleger (und zugleich Herausgeber der Anthologie) Thedel von Wallmoden hatte aus Anlass dieses runden Geburtstages Autorinnen und Autoren gebeten, „etwas über ihre sehr persönlichen Erfahrungen und Eindrücke in der Zusammenarbeit mit einem Lektor mitzuteilen“. Dies steht im Nachwort, das ich tatsächlich nicht als Vorwort gelesen habe, und so fiel mir lediglich irgendwann auf, dass der Namen Thorsten Ahrend in der Anthologie verdächtig häufig fiel. Nun weiß ich nicht, wie viele Autorinnen und Autoren Thedel von Wallmoden um Auskunft gebeten hatte, aber verwunderlich ist es nicht, dass sich vor allem die angesprochen gefühlt haben dürften, die ihrem Lektor Thorsten Ahrend verbunden sind.
Ich bin immer noch nicht sicher darüber, ob es ehrlicher gewesen wäre, das Buch explizit als eine Hommage an den Lektor Thorsten Ahrend auszuweisen, gleich zu Beginn, oder ob man es als kleine Herausforderung für den Leser sehen sollte … Nachdem ich erkannt hatte, dass die meisten Texte sich explizit an einen, den Lektor Thorsten Ahrend richten, habe ich jedenfalls mit dem Lesen noch mal von vorn angefangen und es war anders. Denn es ist doch tödlich langweilig, wenn ein Autor nur über ‚den‘ Lektor sinniert, einen allgemeinen Lektor, keinen aus Fleisch und Blut. Da bleibt alles vage, das muss öde sein. Viel spannender ist es, wenn nicht nur die Persönlichkeit des Autors, sondern auch die des Lektors aufscheint, wenn man eine Vorstellung von dem Gegenüber des Autors bekommt. Der Autor hat ’seinen‘ Lektor, der Lektor ’seinen‘ Autor. Es ist etwas ganz Intimes, und das verträgt sich nicht mit einem anonymen Lektor. Finde ich.
Wiederum verstehe ich auch, warum der Anlass des Buches nicht so groß deklariert wird, denn mit einem allgemeinen Titel und vielen Autorennamen lassen sich eben mehr Leser und Neugierige erreichen. Falsch ist das so nicht, da die Autorinnen und Autoren sich nicht an Thorsten Ahrend klammern, sondern tatsächlich eine enorme Vielfalt an Gedanken über die Zusammenarbeit von Autor und Lektor liefern.
Bringt das Buch jemandem etwas, der Lektor werden will? Nun ja, naturgemäß erfährt man mehr über den jeweiligen Autor. Und darüber, was ein ‚guter‘ Lektor seiner Meinung nach leistet, was ihn auszeichnet. Wie man ein ‚guter‘ Lektor wird, ist hier nicht das Thema. Und es besteht schon die Gefahr, angesichts des Lobs der Lektorkoryphäen zu schrumpfen und sich zu fragen: Geht das? Krieg ich das hin? Na, man könnte es ja auch als Ansporn nehmen! Davon abgesehen, dass Thorsten Ahrend häufig auftaucht – werden als ‚legendäre‘ Lektoren im Buch tatsächlich nur Männer genannt, oder habe ich eine Frau übersehen? Helmut Frielinghaus, Christian Döring – gibt es keine großen Lektorinnen? Lediglich eine nennt Thedel von Wallmoden im Nachwort, die Lyrikerin Elisabeth Borchers, die bei Luchterhand und Suhrkamp arbeitete.
Ich schrieb oben bereits, dass diese Buch ‚viel‘ ist. Man kann viel mitnehmen, rausnehmen. Man kann es weglegen, wieder zur Hand nehmen. Noch mal lesen. Es wird nicht langweilig, es beschäftigt einen.
Ein paar Appetithappen aus dem Buch:
1. Der Lektor als Hebamme und Kritiker
„Ich brauche zweierlei: den Lektor, der mir hilft, meine Idee zu entwickeln, den, der mich anspornt, der nachfragt, mir zuhört, mich Fehler machen lässt, das Buch in seiner frühen Form begleitet – und dann den zweiten, der mich am Ende des Manuskripts empfängt, mit offenen Armen, aber eben auch mit jenem frohlockenden Grinsen: O.K., und jetzt können wir anfangen, an Details zu arbeiten. Die erste Beziehung ist eine sokratische. Mein Lektor ist eine Hebamme. Die zweite eine kritische (…).“ (Matthias Göritz)
2. Ein Lektor – zwei Arten
„Es gibt unter den Lektoren Experten für Plot und Geschichten, und es gibt Experten für Stil.“ (Daniel Kehlmann)
3. Der Lektor als Autor
„Aber zumindest müsste er, um ein guter Leser zu sein, auch selbst schreiben, und seien es auch nur Kritiken und Essays, in denen er selbst die Maßstäbe entwickelt, nach denen er die Manuskripte anderer beurteilt.“ (Peter Hamm)
4. Der Autor als Lernender
„Der Autor lernt etwas über sein Schreiben, am Detail. Sicher war die Grammatik nicht das wichtigste. Was zu lernen war: Genauigkeit und Respekt vor den Regeln einer Sprache, die natürlich auch über Bord geworfen werden konnten, aber nur bei vollem Bewußtsein.“ (Lutz Seiler)
5. Mein Lektor, mein Gott
„Jedes Wort meines Lektors lege ich auf die Goldwaage. Nicht nur: was sagt er, sondern auch: wie sagt er es? Welche Worte benutzt er? Wie betont er sie? Macht er längere Pausen, während er mir etwas zu erklären sucht? Was bedeutet das?“ (Kai Weyand)
6. Der Lektor ist schuld
„Häufen sich in einer Neuerscheinung orthographische Fehler und stilistische Schnitzer, dann wird nicht selten dem Lektor die Schuld in die Schuhe geschoben: ‚Da hätte das Lektorat sorgfältiger arbeiten können‘, beschwert sich der Rezensent. In Wahrheit hat natürlich der Legastheniker, der als Verfasser firmiert, mit immer neuen Änderungen an seinem Manuskript alle Beteiligten in den Wahnsinn getrieben.“ (Steffen Jacobs)
Ach, es gibt viele Sätze in diesem Buch, die man sich unterstreichen möchte. Und gleich zwei Texte scheinen titelgebend für die Anthologie gewesen zu sein. So bezeichnet Matthias Göritz das Schreiben als „Seiltanzen über dem Abgrund, Aufbruch ins Unbekannte“. Und Günter Kunert schreibt: „Ich gebe zu: Lektor zu sein gleicht der Tätigkeit des Seiltänzers. Einerseits möchte er den Autor weder kränken noch verärgern, andererseits sieht er jedoch dessen Schwächen und sprachliche Verirrungen, die er guten Gewissens nicht durchgehen lassen kann.“ Mit Autor und Lektor treffen sich also zwei Seiltänzer, die bestenfalls harmonieren.
Aber zurück auf den Boden der Tatsachen. Im Buch geht es um Verlagslektoren. Solche, die einen Autor, eine Autorin über längere Zeit hin intensiv betreuen, die nicht nur das Manuskript erhalten und es bearbeiten, sondern darüber hinaus Bezugsperson sind. Zu lesen ist von Autor-Lektor-Treffen, bei denen das Manuskript Satz für Satz besprochen wird. Ein Traum! Das Lektorat ist allerdings etwas, das in den meisten Verlagen zunehmend ausgelagert und in die Hände freier Lektoren übergeben wird. Lässt sich unter diesen Umständen eine solche Beziehung aufbauen und halten?
Ach, und ein schönes Buch ist „Seiltanz. Der Autor und der Lektor“ auch. Hardcover, Schutzumschlag, liegt gut in der Hand. Ich empfehle es wärmstens! Und um den Kreis zu schließen: Das Buch der Bachmann-Preisträgerin Maja Haderlap, „Engel des Vergessens“, hat Thorsten Ahrend lektoriert. Natürlich.
Seiltanz. Der Autor und der Lektor
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Thedel v. Wallmoden
18,00 Euro
Wallstein Verlag Juli 2010
208 Seiten
ISBN: 978–3‑8353–0741‑4