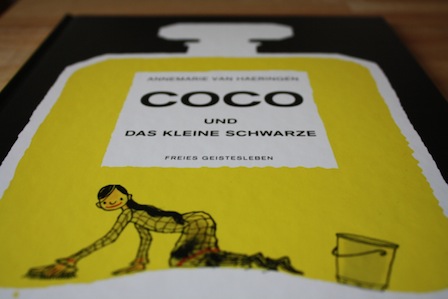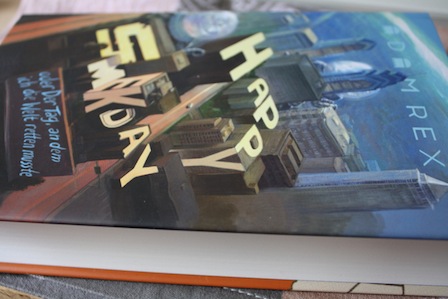Ja, Kopf oder Herz, das ist ein bisschen plakativ, aber es passt: Auf Empfehlung habe ich dieser Tage Joël Dickers „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ gelesen. Das Buch lag eine Weile herum, unter anderem, weil es über 700 Seiten hat. Kleine Schrift. Die Zeit muss man ja erst mal haben. Und mein Bücherstapel ist groß. Als ich nun also las, konnte ich nicht mehr aufhören. Und Seiten überspringen bzw. überfliegen, was manche Wälzer problemlos erlauben, ging leider auch nicht. Weil es dauernd wichtige Wendungen gab und keine Seite zu viel war.
Es ist eine Art Krimi, mit Leiche und Ermittlungen. Es ermittelt Marcus Goldman, Schriftsteller, Anfang dreißig, der einen Erfolgsroman verfasst hat und dem danach nichts Neues einfällt. Da kommt ihm der Fall (kann man wörtlich nehmen, Fall wie fallen) seines Mentors, des berühmten Schriftstellers Harry Quebert, gerade recht. Natürlich nur aus Freundschaft reist Marcus in die Höhle des Löwen und versucht herauszubekommen, was vor dreiunddreißig Jahren zwischen Harry Quebert und Nola geschah.
Das Buch wechselt zwischen Vergangenheit (1975) und Gegenwart (2008), wie eine Zwiebel, Schicht um Schicht, entblättert Marcus die alte Geschichte, bis er am Ende schließlich auf die nackte Wahrheit stößt. Vielleicht. Kurzweilig ist das Buch, fesselnd. Aber es packt einen nicht unmittelbar, es zieht einen nicht in einen emotionalen Sog, es bleibt eine Distanz, das Ganze ist gar zu perfekt konstruiert, man sieht zum Ende hin regelrecht den Autor, Joël Dicker, am Roman-Reißbrett vor sich, wie er noch eine Wendung reinpackt und dabei zufrieden oder leicht verrucht grinst. Es ist nur „eine Art“ Krimi, da im Zentrum der Geschichte die zwei Schriftsteller, Marcus Goldman und Harry Quebert, stehen – ihre Mühen beim Schreiben, das Nichtschreibenkönnen, das glückliche Schreiben usw., noch dazu ist jedem Kapitel ein Tipp, den Mentor Quebert seinem Protegé Marcus einst zum Buchschreiben gegeben hat, vorangestellt.
Zweierlei hat mich an dem Buch genervt: zum einen der Name der weiblichen Hauptfigur, Nola. Das klingt so schrecklich nach „nölen“. Zum andern die Beziehung zwischen Harry Quebert und Nola. Ich verrate jetzt mal, dass der Mann über dreißig und das Mädchen fünfzehn ist, als sie sich verlieben. Nun geht das Buch nicht ins Detail, der Autor überlässt es der Fantasie des Lesers, ob die beiden ins Bett steigen oder nicht. Jedenfalls duzt er sie und sie siezt ihn. Eisern. Wenn Joël Dicker auf Englisch geschrieben hätte, könnte man’s auf den Übersetzer schieben, aber das Original ist französisch, und da gibt es kein „you“, sondern „tu“ und „vous“. Ein wichtiges Element der Geschichte ist also diese Liebe zu einer Minderjährigen. Die vermeintlich ganz große Liebe mit schmachtendem Mädchen und Hin-und-weg-Mann, der sich zusammenreißen will, weil das ja alles nicht geht mit der Kleinen. Muss das sein? Gähn!
Trotzdem mag ich das Buch. Weil es spannend ist. Weil man sich nach dem Lesen noch den Kopf darüber zerbrechen kann (wenn man Lust hat). Und weil es von Autoren und vom Schreiben handelt.