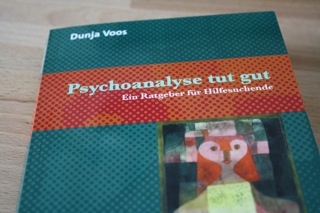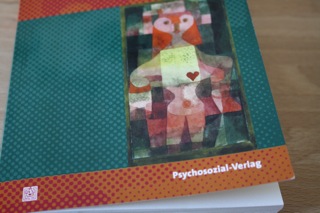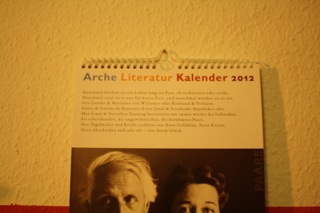Bei diesem Buch, „Sternenkraut“ von Susanne Mittag, hatte mich das Cover angesprochen: grün und schwarz, etwas verspielt, und auch der schöne Titel. Der Klappentext klang gut, und so war klar, dass ich es lesen musste. Es landete dann nicht als „richtiges“ Buch, sondern als E‑Variante bei mir, kein Problem, dafür bin ich gerüstet. Aber ich hab beim Lesen ganz eindeutig das Greifbare vermisst, das Cover, das ich anfassen möchte, die Seiten, die ich umblättern und auch mal rückblättern will – es war kein vollwertiges Leseerlebnis für mich, dem E‑Book fehlt einfach etwas. Oder kann sich jemand „Die unendliche Geschichte“ mit einem Kindle vorstellen, und „Tintenherz“ mit einem iPad statt des Buches?

Was für Bastian aus der „Unendlichen Geschichte“ Herr Koreanders Buchladen ist, ist für Stella aus Susanne Mittags „Sternenkraut“ der Blumenladen ihres Vaters. Hier fühlt die Dreizehnjährige sich wohl, ganz in ihrem Element. Am liebsten würde sie nur im Blumenladen ihre Freizeit verbringen, Freunde hat sie sowieso nicht, Mädchen ihres Alters mit ihrer Vorliebe für „Glitzersteinchen und Haarbänder“ sind ihr ein Rätsel.
Stella lebt allein mit ihrem Vater, ihre Mutter ist gestorben, als das Mädchen zwei Jahre alt war. Sie scheint ein ganz normaler Teenager zu sein, sie redet und verhält sich nicht anders – etwas ungewöhnlich ist nur ihr „grüner Daumen“ und die Tatsache, dass sie Walisisch spricht, was die Sprache ihrer Mutter gewesen sein soll. Doch als die Geschichte beginnt, erfährt Stella die Wahrheit über „ihr“ Walisisch, und es tritt ein fremder, seltsamer Mann – und mit ihm eine andere Welt – in Stellas Leben. Der Junge Kian entführt sie in diese Parallelwelt, in der noch Pferdekutschen fahren, Gaslaternen Licht spenden und die Menschen seltsam altmodisch gekleidet sind.
Um wieder in ihre eigene Welt – und zu ihrem Vater – zurückkehren zu können, muss Stella zuerst Kian zu den Unterirdischen begleiten, die etwas haben, das er dringend braucht – und das er ohne ihre Hilfe nicht bekommen kann. Mit dabei sind der undurchsichtige, dunkle Faar und die Tierflüsterin Tasne. Mehr soll von der Geschichte nicht verraten werden, mein Tipp: selber lesen!
Das Buch ist spannend und dicht geschrieben, es gibt keine Längen. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass Susanne Mittag etwas ausschweifender erzählt und ein paar Seiten mehr verfasst hätte, für Fantasy-Verhältnisse ist „Sternenkraut“ sehr konzentriert und fast sachlich. Wenn ich sagen müsste, ob das Buch mehr Kopf oder Herz sei, wäre meine Antwort: mehr Kopf. Das fällt gerade in Situationen auf, die eigentlich emotional absolut aufgeladen sein müssten, aber tatsächlich eher nicht so rüberkommen, gleich, ob es um große Gefahren oder eine einschneidende Familienangelegenheit geht.
Eine Botschaft hat das Buch, welche, sage ich an dieser Stelle natürlich nicht, aber sie ist nicht zu überlesen, denn sie wird am Schluss ein paar Mal explizit genannt. Das Ende ist relativ offen, es fehlen ein paar Szenen, die der Leser doch erwartet hätte, es sieht also sehr nach einer Fortsetzung aus. Die ich lesen würde, da ich erstens wissen möchte, wie es mit Stella und ihren zwei Welten weitergeht, und zweitens Susanne Mittags Schreibe sehr angenehm finde. Wenn sie ein wenig „epischer“ schreiben und auch mal richtig dick und gefühlig auftragen würde, ab und zu, dann wäre es (für mich) perfekt. Und ein wirklich böser Bösewicht (ob nun subtil oder vordergründig) wäre ebenfalls nicht verkehrt.
Also: ein empfehlenswertes, fesselndes Fantasy-Abenteuer mit einer ganz schön lebensnahen Heldin, die eher der bodenständige Typ ist, aber eine besondere Gabe hat, die sie in Schwierigkeiten (in eine andere Welt!) bringt – und ihr gleichzeitig neue Freunde und wichtige Erkenntnisse über ihre eigene Familie beschert.
* * * * *
Susanne Mittag
Sternenkraut
ab 10 Jahren
Ueberreuter
208 Seiten
12,95 Euro
ISBN: 978–3‑8000–5649‑1