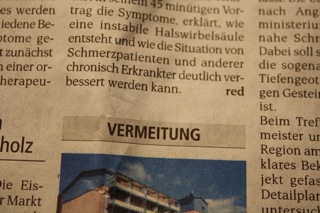Letztes Jahr bin ich Kluftinger verfallen. Zuerst war das Cover, das fand ich frisch und ansprechend. Dann klang der Klappentext nicht schlecht, also Buch aus der Bibliothek ausgeliehen und bald angefangen zu lesen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch der Reihe es war – die Krimibranche macht es den Lesern ja auch schwer mit diesen Ein-Wort-Buchtiteln. Wer soll sich denn da zurechtfinden, wer soll sich das merken? Und es liegt nicht nur an den Titeln, dass man die Kluftinger-Bücher schnell mal verwechselt, auch die Geschichten ähneln sich. Im Mittelpunkt steht Kluftinger, der Kommissar ohne Vornamen, auf der einen Seite seine Familie, die Erika, der Sohn und dessen Freundin, auch die Eltern, auf der anderen Seite der Job inklusive Kollegen und den „Bösen“, die es zu finden und aufzugreifen gilt.
Die Fälle haben mich eigentlich nie vom Hocker gerissen – die sind nicht langweilig geschrieben, aber am Laufen hält das Ganze doch der Herr Kluftinger mit seinem Verhalten und seinen Macken. Man sollte nicht zu viele Kluftinger-Bücher zu dicht aufeinander lesen, sonst wird einem das schnell zu viel: die Hassliebe zu Dr. Langhammer, die Angst davor, Männern zu nah zu kommen, die Klo‑, Ess‑, Schlaf- und anderen Gewohnheiten, das Sandy-Nerven usw. Was Überraschendes wird es von Kluftinger vermutlich auch in Zukunft nicht geben, die beiden Autoren Volker Klüpfel und Michael Kobr fahren mit ihrem Konzept ja bestens, erstaunlich bis bewunderswert, was sie mit ihrer Kluftinger-Welt alles auf die Beine gestellt haben, so gibt es mittlerweile ein Kochbuch und ein Lesereisenbuch.
Im „Schutzpatron“ spielt das Essen keine so große Rolle, Kluftinger hat Pech und bekommt z. B. bei einem Kurztripp nach Österreich keine Wiener Leckereien vorgesetzt, sondern muss bei einem Kollegen übernachten, der ein Messie ist und nur eklige Sachen im Kühlschrank hat. Das ist auch so übertrieben geschildert, dass es fast wieder wahr sein muss. Der Fall selbst: eine alte, unbeliebte Frau wird ermordet, ein Kunstschatz kehrt nach Altusried (Kluftingers Heimatdorf) zurück und es gibt Hinweise, dass eine hochprofessionelle Truppe unter Leitung des „Schutzpatrons“ ihn stehlen will, außerdem ist Kluftingers Auto geklaut worden, was ihm so peinlich ist, dass er es niemandem erzählt.
Hat wieder Spaß gemacht, das Buch zu lesen, auch wenn das Übertriebene, Karikaturhafte manchmal doch nervt. Aber ein Mal im Jahr ist das okay und gute Unterhaltung. Natürlich wird es weitergehen, und Kluftinger wird irgendwann einmal wieder auf den Schutzpatron treffen, das verklickern Klüpfel und Kobr den Lesern überaus deutlich. Na denn, bis bald!