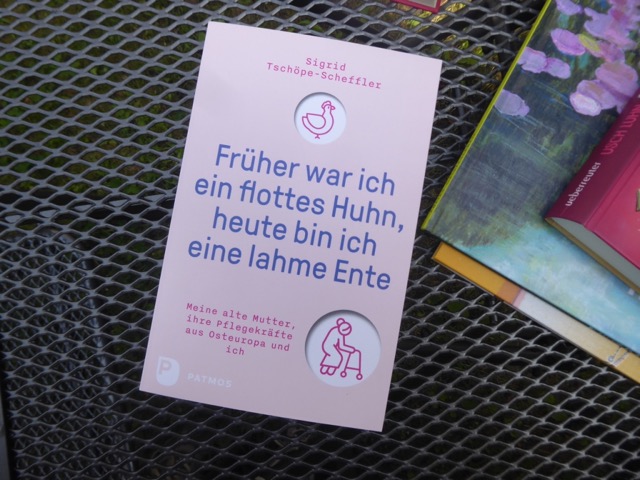Florence Nightingale, der Name dürfte nach wie vor vielen etwas sagen, aber mehr als „diese bekannte britische Krankenschwester“ fällt den meisten wahrscheinlich nicht ein, mir jedenfalls ging es so. Also kam diese Biografie von Nicolette Bohn gerade recht, die anlässlich Nightingales 200. Geburtstag am 12. Mai 2020 erschienen ist.
Das Buch ist mit 176 Seiten relativ schmal, es war bestimmt anspruchsvoll, sich so zu beschränken. Gibt es doch, wie die Autorin erzählt, jede Menge Text aus Nightingales eigener Feder, zum einen ihre Bücher, zum andern 14.000 (!) Briefe sowie Tagebücher und Notizen. Logisch, dass man dann Schwerpunkte setzen muss, in diesem Fall sind es folgende: Kindheit und Jugend, Suche nach der Berufung, Krimkrieg, Jahre nach dem Krimkrieg. Am umfangreichsten ist Punkt 2, Suche nach der Berufung.
1820 wurde Florence Nightingale geboren. Sie entstammte einer wohlhabenden Familie und hatte Zugang zu einer guten Bildung. Ihre Eltern konnten sich mehrere Wohnsitze und ausgedehnte Reisen leisten und ermöglichten ihr, einflussreiche Leute kennenzulernen. Florence‘ Wunsch, Krankenpflegerin zu werden, unterstützten sie allerdings nicht, sondern kämpften jahrelang dagegen an, vor allem wohl, da das zu der Zeit eine verrufene Tätigkeit war, für die man keinerlei Qualifikationen benötigte. Dass sich dies änderte, daran hatte Florence Nightingale einen Anteil. In diesem Buch geht es aber mehr um ihr Werden, nicht um ihr Werk und ihre Verdienste, wobei diese natürlich Erwähnung finden.
Wie das bei Biografien so ist, muss die Leserin, der Leser etliche Namen und Daten jonglieren. Hilfreich ist hier der Anhang, in dem ein Überblick über die Lebensstationen sowie ein Personenverzeichnis zu finden sind. Die Autorin lässt viele, zum Teil längere Zitate von Florence Nightingale und Zeitgenossinnen und ‑genossen einfließen, sodass man besser in diese Zeit eintauchen kann. So richtig greifbar wird mir „diese bekannte britische Krankenschwester“ am Ende nicht, auch wenn ich viel über sie erfahre. Was sicher daran liegt, dass eine solche eher schmalere Biografie nur ein Anfang sein kann.

Nicolette Bohn: Florence Nightingale. Nur Taten verändern die Welt
Lektorat: Burkhard Menke
176 Seiten
2020 Patmos Verlag
ISBN 978–3‑8436–1225‑8
19 Euro