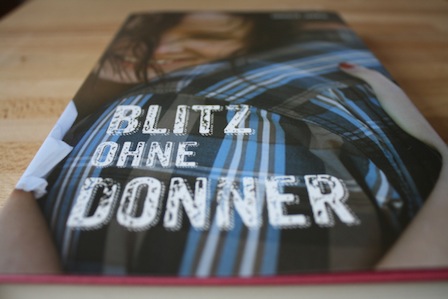Birgit Ebbert lädt zur Blogparade mit dem Thema „Meine Stadt von A bis Z“ ein, ich habe mir den Kopf über Schwarzenberg zerbrochen. Bei manchen Buchstaben war es knifflig, und so habe ich mich ab und zu bei der hiesigen Mundart, dem Erzgebirgischen, bedient.
A – Altstadt, Altstadtfest, a nei Gahr (frohes neues Jahr)
B – Becherberg, Brückenberg, Bertolt-Brecht-Gymnasium, Bermsgrün, Bahnhofsberg, Bärenhöhle, Hans Brockhage (Bildhauer), Jörg Beier (Bildhauer), Marcus Beyer (Boxer)
C – Café am Markt, Crandorf
D – Dionysos, daamisch (dämlich, blöd), Dez (Kopf), Dingerich (komischer Kerl), drham (daheim, zu Hause), Dus (Dose, Steckdose)
E – Egermannbrücke, Eisenbahnmuseum, Erla
F – Freie Republik Schwarzenberg, Foron, Ralf Alex Fichtner (Maler, Grafiker), Walter Fröbe (Pädagoge, Heimatforscher)
G – Galgenberg, Galerie Rademann, Grünstädtel, Ricco Groß (Biathlet)
H – Hofgarten, Heide, Herrenmühle
I – itze (jetzt)
J – Jägerhaus, Ernst Jünger (Schriftsteller, seine Familie lebte 1901 bis 1905 in Schwarzenberg)
K – Kunst und Kneipe, Kreuz-Erfindung-Stolln, Kraußpyramide, Krauß-Werke, Friedrich Emil Krauß (Industrieller, Erfinder)
L – Latsch (Schuh)
M – Markt, Meißner Glockenspiel, Mittweida (Fluss)
N – Naturbühne, Neustadt, Neuwelt
O – Oswaldtal, Ottenstein, Ostermarkt, Olympia-Kino (gibt es nicht mehr)
P – Pollermann (Gaststätte), Pöhla
Q – quarzn (rauchen)
R – Rockelmann, Ritter-Georg-Halle, Rösslberg, Ratskeller, Ringkino, Restaurant Rrush, Elisabeth Rethberg (Sopranistin, verbrachte Kindheit und Jugend in Schwarzenberg, sang ab 1922 an der Metropolitan Opera in New York)
S – Schwarzwasser, Stadtschule, Sonnenleithe, Sonnenbad, Stadtbad (gibt es nicht mehr), Straße der Einheit, Stefan-Heym-Denkmal (wegen Stefan Heyms Roman „Schwarzenberg“), Schloss Schwarzenberg, St. Georgenkirche, Stadtbibliothek, Schlosswald, Ernst Schneller (Lehrer, Politiker (SPD, KPD), 1944 ermordet im KZ Sachsenhausen), Harry Schmidt (Schnitzer)
T – Totenstein, Töpfermarkt, Türmer, Tag der Sachsen (war im September 2013 in Schwarzenberg), Tettauer
U – Unbesetzte Zone (21 Städte und Dörfer der Landkreise Schwarzenberg und Stollberg blieben nach dem 8. Mai 1945 sechs Wochen lang „unbesetzt“)
V – Vorstadt, Vugelbeerbaam, Viadukt
W – Waldbühne, Weihnachtsmarkt, Wildenau
X – (Kreuzchen bei der Wahl zum Europäischen Parlament, zum Kreistag und zum Stadtrat am 25. Mai 2014)
Y – (In und um Schwarzenberg gibt es genug Wald, wo man auch mal mit der Schleuder – Y‑Form! – schießen kann, ohne jemandem in die Quere zu kommen)
Z – Zeich (Zeug, Sachen)
Mehr über meine Stadt gibts zu lesen (und zu sehen) auf schwarzenberg-blog.de.
Ein erzgebirgisches Wörterbuch findet sich zum Beispiel unter erzgebirgisch.de.